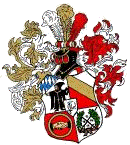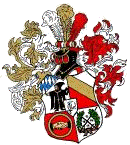Die Münchener Verbindung Rupprechtia

Gründung im Jahr 1916
München 1916. Die Absolventen der kgl.
Rupprecht-Kreisrealschule saßen in bierseliger Laune beisammen,
das weiß-grün-weiße Absolvia-Band um die Brust, die roten
Schülermützen keck aufs Haupt gedrückt. Man freute sich, daß
die elende Paukerei endlich vorbei war, und man war wohl auch ein
wenig traurig, die Freunde langer Schuljahre für immer aus den
Augen zu verlieren.
In dieser Stimmung wohl wurde die Idee geboren, sich an einem
studentlichen Stammtisch auch weiterhin zu treffen. Ein Name war
rasch gefunden: "Absolvia-Vereinigung Feuchtes Eck".
Man entwarf einen Zirkel (Zeichen der Verbindung, das hinter dem
Namen gesetzt wird), der das F.E. des Vereinsnamens enthielt.
Ein Tagebucheintrag aus dem Jahre 1917
schildert diesen Stammtisch: "Zum ersten Mal nach 5 1/2
Monaten schlich ich wieder die berüchtigte Treppe zum Burghof
hinan. Endlich sollte ich wieder den bedeutenden Blick um die
linke Ecke tun können...! Ich war nicht enttäuscht. Ich fand
sie aufrecht, sieben an der Zahl."
Aber auch die Absolventen des Jahrgangs 1917 beschlossen, die
jahrelange Schulfreundschaft weiterzupflegen und sich
regelmäßig im Turmzimmer der Löwenbrauerei zu treffen.
Die 1916er aus dem "Burghof" bekamen Wind von der neuen
Vereinigung und schickten eine Abordnung ins
"Turmzimmer".
Ein Gegenbesuch erfolgte im Burghof bei den "bemoosten
Häuptern".
In einigen folgenden Treffen kristallisierte sich der Gedanke an
eine Vereinigung aller Absolventen der Rupprecht-Schule heraus.
Am 8. November 1917 fand die erste gemeinsame Veranstaltung der
beiden Jahrgänge statt.
In der Chronik liest man:
"Mit dem heutigen Tag, besser gesagt Abend, setzt offiziell
für die Rupprechtia eine neue Ära ein. Die Absolventen des
alten Kastens kgl. Rupprecht-Kreis-Realschule von 1916 und 1917
haben sich vereinigt und bilden eine Corona, die Verbindung
"Absolvia Rupprechtia", Farben sind weiß-gold-weiß,
neuer Zirkel !"
Die Mitgliederzahl hatte sich mit einem Schlag von etwa 15 auf
etwa 27 erhöht.
Die Form des reinen Stammtisches war schon vor dieser Fusion
verlassen worden, man arrangierte Tanzveranstaltungen, schlug
Kneipen und feierte das 1. Stiftungsfest.
Die Aktivitäten und die Häufigkeit der
Zusammenkünfte sind heute kaum mehr vorstellbar.
Jeden 2. Samstag Offizium, jeden Sonntag
gemütliche Unterhaltung oder Ausflüge, jeden Mittwoch
Zusammenkünfte. Dazwischen gestreut zahlreiche
"Damenkneipen", Sylfesterfeier, Nikolauskneipe,
Stiftungsfest und Faschingsbälle.
Inzwischen waren eine Reihe von Rupprechten in den Krieg gezogen,
die ersten bereits gefallen "für Kaiser und Reich".
Im "Bürgerstüberl" in der Ysenburgstraße am
Rotkreuzplatz fand die Verbindung von 1918 bis 1983 eine
ständige Bleibe. 1983 erfolgte der erste Umzug in die
"Gartenlaube", Blutenburgstraße. Weitere Stationen
waren das "Schwabinger Bräu" in der Leopoldstraße und
der "Großwirt" in der Winthirstraße. Heute ist die
Konstante das "Ewige Licht" in der Arnulfstraße 214a
in der Nähe vom Steubenplatz.
Im Jahr 1918 kam das Verbindungsleben fast
ganz zum Erliegen, die meisten Rupprechten waren an der Front, 5
von ihnen kehrten nicht zurück.
Ende 1918 kamen die Rupprechten nach und nach in die Heimat
zurück, das Bundes- und Farbenleben nahm einen gewaltigen
Aufschwung.
Um die ungeheure Kreativität der damaligen Rupprechten
aufzuzeigen, sei hier ein Auszug aus dem Festprogramm der
Veranstaltung Rupprechtias im Kreuzbräu vom 09.03.1919
vorgestellt:
1. "König Karl Marsch" (gespielt
vom 20(!)-köpfigen Hausorchester)
2. Begrüßungsrede
3. "Bajazzo"-Lied (Gesang, begleitet am Flügel)
4. Gavotte (Tanzeinlage)
5. "Kalif von Bagdad", Ouvertüre (Hausorchester)
6. "Nachtstimmung", ein symphonisches Tongemälde
"Ballade", ein Melodram
(2 Kompositionen eines Rupprechten, Rezitation mit Begleitung am
Flügel)
.
.
9. Damenrede
10. "Schmetterlinge" (Ein selbstverfaßtes Lustspiel in
1 Akt)
Es folgten weiterhin, neben musikalischen
Darbietungen, der Zweiakter "Der kranke Mann", ein
Elfentanz, eine Walzervorführung und ein vielbejubelter
Schleiertanz.
Nach dem offiziellen Schluß folgten "Brettlgedichte",
eine frei improvisierte Duo-Szene, ein spontanes Violin-Solo und
Stehgreif-G'stanzln auf die Anwesenden.
Der Erfolg des Abends muß ungeheuer gewesen sein.
Doch zurück zur Geschichte des Bundes.
1919 wurden die Verbindungsfarben weiß-gold-weiß in die noch
heute bestehenden weiß-gold-rot abgeändert, kurz darauf
entstand aus dem bisherigen Absolventen-Zirkel der heutige
Rupprechten-Zirkel!
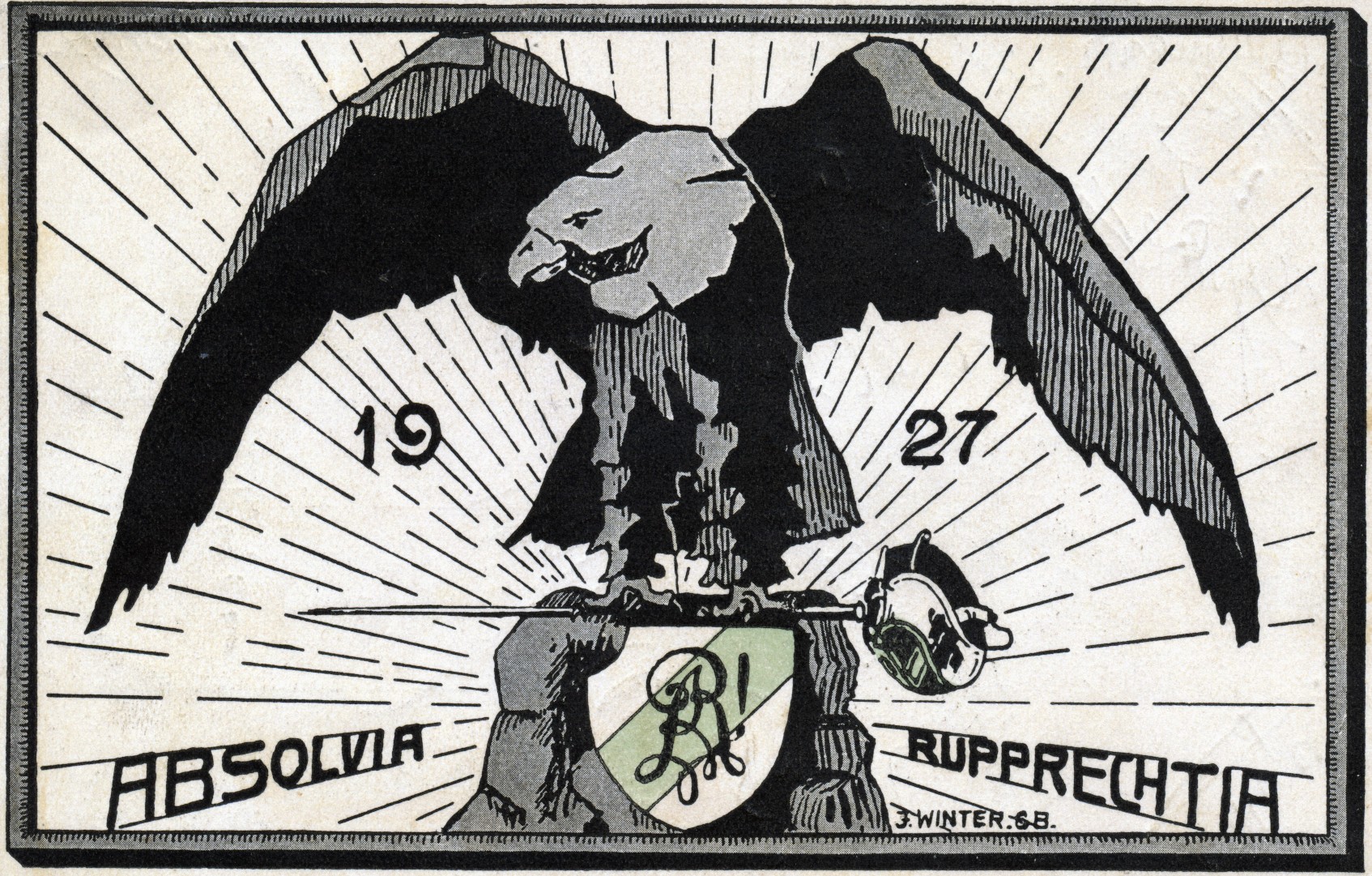
Es folgten Jahre regen Verbindungslebens und
stetig steigender Mitgliederzahlen. Kein Stiftungsfest von
befreundeten Verbindungen im Süddeutschen Raum, an dem nicht
eine Abordnung Rupprechtias ihre Trinkfestigkeit unter Beweis
gestellt hätte.
Am 12.04.1933 fand ein Konvent statt, der sich
mit der geänderten politischen Lage in Deutschland befaßte. Es
gab nun einen "Großdeutschen Absolventenring", einen
"Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund". Die
Eingliederung der farbentragenden Verbindungen in die
nationalsozialistische Bewegung war vollzogen. Dieser Schritt
war, wenn auch noch unerkannt, der Anfang vom Ende des
Verbindungswesens.
1935 folgte ein Erlaß des
Reichsjugendführers, wonach es Mitglieder der HJ verboten war,
einer farbentragenden Verbindung anzugehören.
So war denn der einzige Tagesordnungspunkt des
Gerneralkonvents vom 23. Oktober 1935: "Auflösung der
Rupprechtia".
Schwer muß gerungen worden sein, bis lange nach Mitternacht die
Auflösung des Bundes beschlossen wurde.
Allerdings wollte man sich nicht völlig trennen. Als
"Vereinigung ehemaliger Angehöriger der
Rupprecht-Oberrealschule" sollten weiterhin Treffen
stattfinden. Ohne Band und Mütze, ohne Kneipen und sonstige
Couleur-Veranstaltungen.
Mit dem Entschluß der Auflösung war man der
Zeit nur wenige Monate voraus, denn bereits an Pfingsten 1936
ordnete die NSDAP die Auflösung aller farbentragenden
Verbindungen an. Die Partei wollte keine anderen Gruppen neben
sich dulden.
Aus der ehemals äußerst aktiven Verbindung
wurde ein Kegelclub, "nicht einmal ein besserer, aber ein
sehr lustiger", wie die Chronik vermerkt.
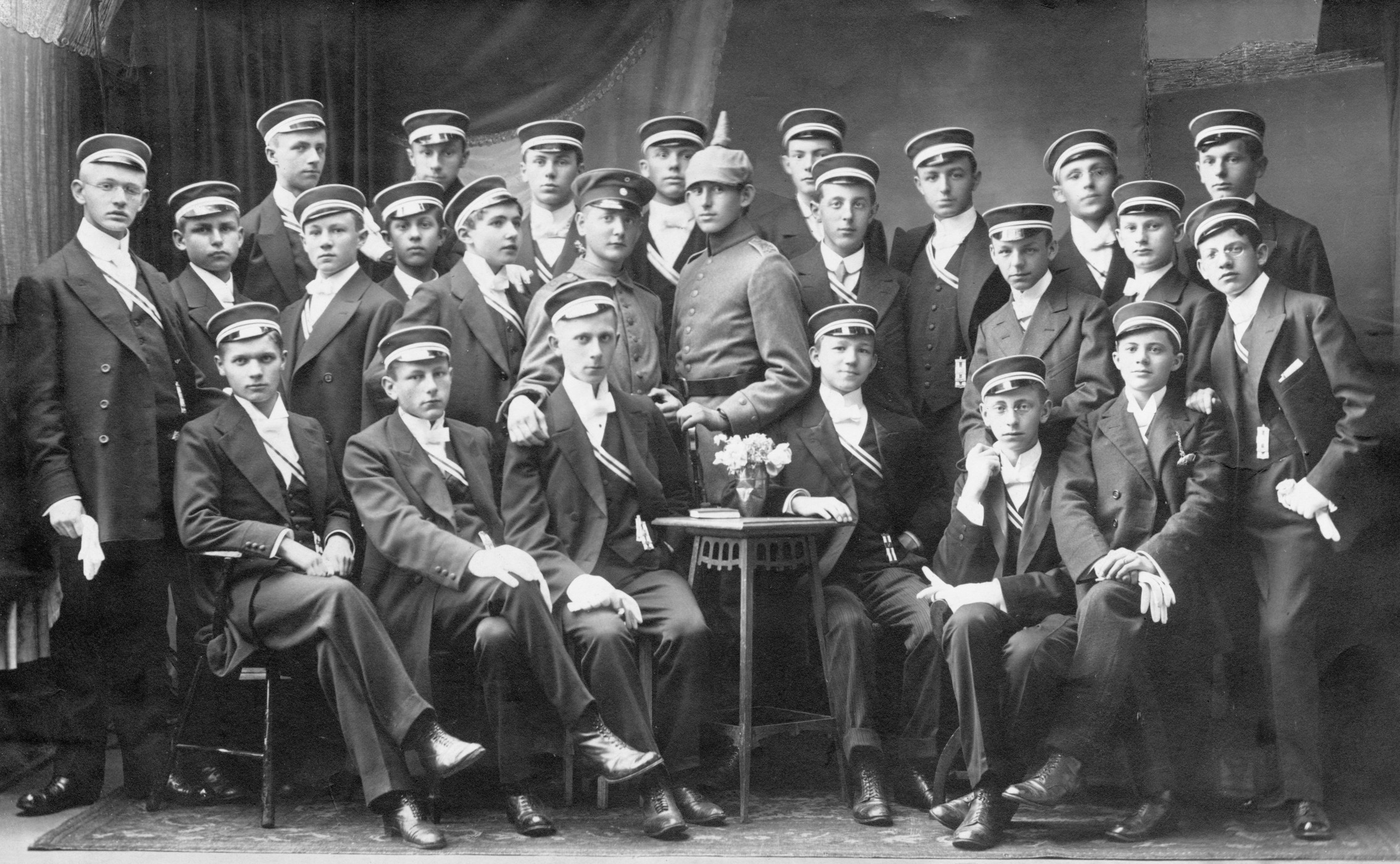
Auflösung der Rupprechtia
Am 1. September 1939 begann der 2. Weltkrieg,
die meisten Rupprechten wurden sofort eingezogen, noch mehr
schrumpfte das Häuflein zusammen. Am 16. Juli 1941 waren es
ganze 9 Bundesbrüder, die im geheimen der Gründung vor 25
Jahren gedachten. In den folgenden Jahren waren es meist nur 3
oder 4 Rupprechten, die sich im "Bürgerstüberl"
zusammenfanden, um zu bereden, wer ausgebombt, wer gefallen war.
1945 waren es 13 Rupprechten, die aus dem mörderischsten aller
Kriege nicht zurückgekommen waren.
In den Nachkriegsjahren kehrten immer mehr Rupprechten aus
Gefangenschaft heim, verlegten ihren Wohnsitz zurück nach
München. Und nun zeigte sich, was eine in 30 Jahren gewachsene
Freundschaft wert war. Die Art und Weise, wie man sich
gegenseitig mit Kleidung, Essen, Unterkunft, kostenloser
Zahnreparatur half, ist für uns heute wohl gar nicht mehr
vorstellbar. An einem Novemberabend 1948 saßen 26 hohlwangige
Rupprechten bei dünnem Bier zusammen, als einer den Vorschlag
machte, doch wieder einmal ein Studentenlied zu singen. Der
Erfolg des Cantus "Denkst Du daran, Genosse froher
Stunden" war durchschlagend, man beschloß spontan eine
Weihnachtsfreier abzuhalten.
Ein neuer Anfang für Rupprechtia!
Man traf sich wieder im monatlichen Rhythmus,
veranstaltete Faschingsbälle, beging das 33. Stiftungsfest.
Das große Problem war die Frage des Nachwuchses. Eine Lösung
zeichnete sich ab, als man beschloß, in Form einer
"Studiengenossenschaft Rupprechtia" weiterzumachen, mit
der Zielsetzung, "die während der Schulzeit begründeten
Freundschaften über die Schule hinaus zu pflegen mit der
Verpflichtung, Schule und Schüler in geeigneter Weise zu
fördern und zu unterstützen".
Damit war der Weg zur Aufnahme von Beziehungen zur
Rupprecht-Schule geebnet, und man fand in Oberstudiendirektor Dr.
Habisreutinger und in Studienrat Dr. Rauch große Hilfe.
Obwohl man beschlossen hatte, nicht zur Form
der Korporation zurückzukehren, wurde doch vereinbart, bei
Stiftungsfesten zur Erinnerung an frühere Zeiten das dreifarbige
Band zu tragen.
1952 veranstaltete die
"Studiengenossenschaft Rupprechtia" erstmals das
"Schülerjahrestreffen ehemaliger Rupprechtschüler"
das seitdem jedes Jahr stattfindet, immer noch organisiert* von
der gleichen Vereinigung, die inzwischen wieder "Münchner
Verbindung Rupprechtia" heißt, Band und Mütze trägt und
zur Form der farbentragenden Verbindung zurückgekehrt ist. Das
Kneipheim ist mittlerweile im "Ewigen Licht" in der Wälsungenstraße
1 (Nähe Steubenplatz).
* Die Organisation des Schülerjahrestreffens wurde mittlerweile den "Freunden des Rupprecht-Gymnasiums" übergeben,
bei denen die M.V. Rupprechtria auch weiterhin mitwirkt.
So hat sich der Kreis geschlossen.
Und das einzige Problem ist der Nachwuchs. Viele Schüler, die
die Schule verlassen, wissen gar nicht, daß es eine
"Münchner Verbindung Rupprechtia" gibt.
Das ändert aber nichts daran, daß sich die
Rupprechten ihrer alten Penne immer noch verpflichtet fühlen, ob
es nun um ein neues Mikroskop für den Biologieunterricht geht,
um einen Zuschuß fürs Landheim oder um anderwertige finanzielle
Unterstützungen (Theatergruppe, Chor usw.).
An den Schluß dieses Rückblicks möchte ich
einen Satz aus der Festrede stellen, die Prof. Dr. Krampf von der
Rupprecht-Oberrealschule bei einem Rupprechtia-Abend im Jahre
1934 hielt: "Es ist ausschließlich der "Münchner
Verbindung Rupprechtia" vorbehalten, die austretenden
Schüler in ihren Reihen zu sammeln.
Nur engste Zusammenarbeit zwischen Schule, Korporation und
Landheimverein können gedeihlich für die Zukunft sein."
Dem wäre nichts hinzuzufügen, außer meiner
Hoffnung, daß es eines Tages wieder so sein möge.
Vivat, crescat, floreat, Rupprechtia!
Giselher Kadmer
M.V. Rupprechtia
© M.V. Rupprechtia